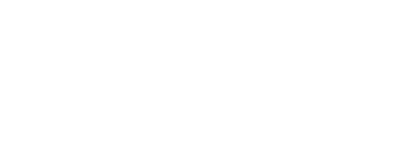Querverweise Würzburg am 21.11.2024
Soziale und gesell-schaftliche Bedeutung von Natur(schutz)
Mit Haluk Soyoglu, Prof. Dr. Michaela Fenske, Kristin Funk, Sebastian Amler
Moderation von Julia-Marie Hiller
„Welchen Wert hat die Natur für uns, und warum lohnt es sich, sie zu schützen?“ Diese Fragen standen am 21. November 2024 im Mittelpunkt eines Vortragsabends der bayernweiten Reihe „Querverweise“, der in der Umweltstation Würzburg stattfand. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Hochschulgruppe Würzburg.
Den Abend eröffnete Sebastian Amler, Sonderpädagogikstudent und Gründer der Gruppe, mit einem Impulsvortrag über die soziale und gesellschaftliche Bedeutung des Naturschutzes. Er stellte Projekte des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) vor, darunter das selbstentwickelte „After Uni Birding/Take a Break“, das Studierenden eine Auszeit vom Alltag bietet. Auch bekannte Initiativen wie der Wiesenbrüterschutz, das Bartgeierprojekt und das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ fanden Erwähnung. Trotz dieser Erfolge betonte Sebastian, dass es im Naturschutz noch viel zu tun gibt.
Im zweiten Teil seines Vortrags richtete er den Fokus auf die persönliche Ebene: Warum sollten wir uns nicht nur gesellschaftlich, sondern auch im Alltag für die Natur einsetzen? Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Ehrenamt und Naturerlebnisse die geistige Fitness fördern, Stress reduzieren und Depressionen oder Bluthochdruck lindern können. Besonders Menschen in Pflegeeinrichtungen profitieren, etwa durch Vogelbeobachtung, die kognitive, motorische und psychosoziale Fähigkeiten stärkt.
Im Hauptprogrammpunkt diskutierten die Teilnehmenden über ihre persönlichen Perspektiven und Ideen – ein inspirierender Austausch, der den Abend abrundete. Nach einer kurzen, mit Vogelgezwitscher untermalten Pause startete der zweite Teil des Abends: die Diskussionsrunde. Auf dem Podium tauschten sich Haluk Soyoglu (Geschäftsführer der NAJU), Prof. Michaela Fenske (Lehrstuhlinhaberin für Europäische Ethnologie und Empirische Kulturwissenschaft), Kristin Funk (Leiterin des Aktivbüros Würzburg) und Sebastian Amler (Sonderpädagogikstudent und Mitglied der Hochschulgruppe Würzburg) zum Thema des Abends aus.
Handlungsempfehlungen
Umgang mit Krisen
Bewusstsein schaffen: Naturschutz betrifft alle, wird aber oft als Luxusthema wahrgenommen.
Dialog fördern: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbeziehen, um aus der eigenen Blase herauszukommen.
Erfahrbarkeit erhöhen: Probleme wie Artensterben sind für viele im Alltag kaum spürbar.
Hilflosigkeit begegnen: Multikrisen überfordern oft und führen zum Rückzug, trotz zahlreicher Handlungsmöglichkeiten.
Hoffnung und Perspektiven geben: Natur als verbindendes Element nutzen.
Gemeinschaft stärken: Aktivität im privaten Rahmen kann helfen, besser mit Krisen umzugehen.


Wie wollen wir über Naturschutzthemen reden?
Kernbereiche der Umweltbildung: Umweltwissen, Umweltverhalten und Umwelteinstellung.
Wissen allein führt selten zu aktivem Handeln – die Einstellung beeinflusst das Verhalten direkt.
Positiv kommunizieren: Vermeidung von rein negativen oder übermäßig wissenschaftlichen Ansätzen.
Ökonomische Argumente nutzen: Der wirtschaftliche Wert der Natur kann überzeugen, sollte aber mit der Botschaft ergänzt werden, dass Menschen Teil der Natur sind.
Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft
Gärten als Beispiel: Orte der Begegnung zwischen Mensch und Natur; Gärtner sind oft von Krisen betroffen, bleiben aber resilient durch ihre Lösungsorientierung und das Gefühl von Selbstwirksamkeit.
Selbsthilfe durch Leidensdruck: Gemeinschaft entsteht, wenn Menschen ähnliche Probleme teilen (bottom-up). In Würzburg fehlt bisher eine Selbsthilfegruppe zu Resilienz/Klimakrise.
Selbstwirksamkeit als Schlüssel: Langfristiges Engagement basiert auf der Erfahrung, handlungsfähig zu sein, was nachweisbar Glücksgefühle steigert.
Gemeinschaftsgefühl stärken: Engagement fördert Zusammenhalt und Resilienz, während der Verlust von Handlungsfähigkeit Frustration erzeugt.
Wertschätzung und Sichtbarkeit: Essenziell, um das Engagement der Menschen zu fördern und zu erhalten.


Lösungen und Ausblick: Naturschutz erleben statt nur darüber reden
Erlebnisse schaffen: Die Schönheit der Natur erfahrbar machen, z.B. mit Projekten wie „Take A Break“, das Gemeinschaft und Naturerfahrung verbindet.
Früh ansetzen: Kindern Selbstwirksamkeit vermitteln, Interesse wecken und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen – sie motivieren auch ihr Umfeld (Schmetterlingseffekt).
Handlungsfähigkeit stärken: Menschen sollen sich selbst als wertvollen Teil der Natur erleben und wahrnehmen.
Dialog fördern: Mit anderen Bevölkerungsgruppen vernetzen, Probleme und Chancen im Naturschutz thematisieren und unterschiedliche Sichtweisen verstehen.
Kreative Ansätze: Neue Methoden wie Kunst oder Film als Zugänge testen – noch experimentell, aber vielversprechend.
Lebensrealität berücksichtigen: Angebote schaffen, die Menschen in ihrem Alltag abholen und motivieren.
Hoffnung bewahren: „We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope“ (Martin Luther King).
Handlungs-
empfehlungen
Umgang mit Krisen
- Bewusstsein schaffen: Naturschutz betrifft alle, wird aber oft als Luxusthema wahrgenommen.
- Dialog fördern: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbeziehen, um aus der eigenen Blase herauszukommen.
- Erfahrbarkeit erhöhen: Probleme wie Artensterben sind für viele im Alltag kaum spürbar.
- Hilflosigkeit begegnen: Multikrisen überfordern oft und führen zum Rückzug, trotz zahlreicher Handlungsmöglichkeiten.
- Hoffnung und Perspektiven geben: Natur als verbindendes Element nutzen.
- Gemeinschaft stärken: Aktivität im privaten Rahmen kann helfen, besser mit Krisen umzugehen.

Wie wollen wir über Naturschutzthemen reden?
- Kernbereiche der Umweltbildung: Umweltwissen, Umweltverhalten und Umwelteinstellung.
- Wissen allein führt selten zu aktivem Handeln – die Einstellung beeinflusst das Verhalten direkt.
- Positiv kommunizieren: Vermeidung von rein negativen oder übermäßig wissenschaftlichen Ansätzen.
- Ökonomische Argumente nutzen: Der wirtschaftliche Wert der Natur kann überzeugen, sollte aber mit der Botschaft ergänzt werden, dass Menschen Teil der Natur sind.

Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft
- Gärten als Beispiel: Orte der Begegnung zwischen Mensch und Natur; Gärtner sind oft von Krisen betroffen, bleiben aber resilient durch ihre Lösungsorientierung und das Gefühl von Selbstwirksamkeit.
- Selbsthilfe durch Leidensdruck: Gemeinschaft entsteht, wenn Menschen ähnliche Probleme teilen (bottom-up). In Würzburg fehlt bisher eine Selbsthilfegruppe zu Resilienz/Klimakrise.
- Selbstwirksamkeit als Schlüssel: Langfristiges Engagement basiert auf der Erfahrung, handlungsfähig zu sein, was nachweisbar Glücksgefühle steigert.
- Gemeinschaftsgefühl stärken: Engagement fördert Zusammenhalt und Resilienz, während der Verlust von Handlungsfähigkeit Frustration erzeugt.
- Wertschätzung und Sichtbarkeit: Essenziell, um das Engagement der Menschen zu fördern und zu erhalten.
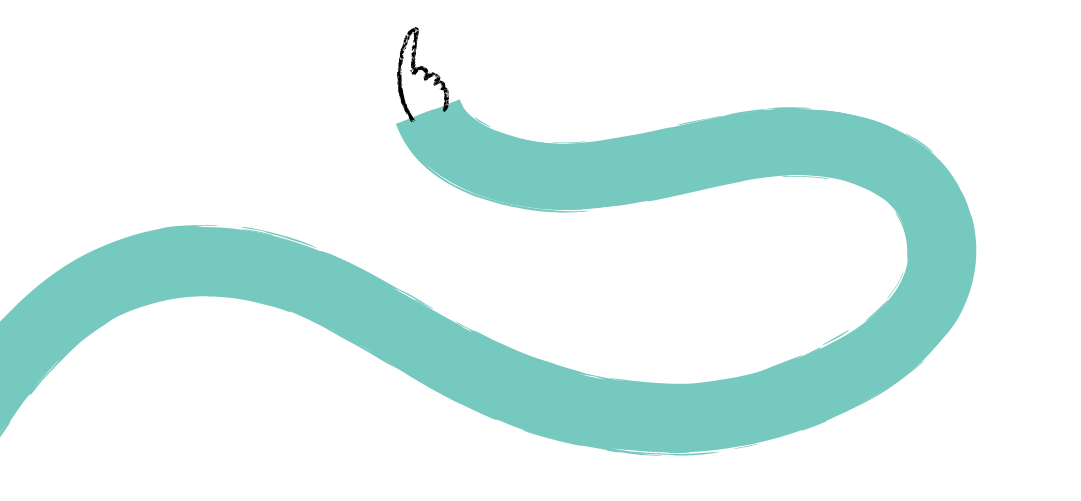
Lösungen und Ausblick: Naturschutz erleben statt
nur darüber reden
- Erlebnisse schaffen: Die Schönheit der Natur erfahrbar machen, z. B. mit Projekten wie „Take A Break“, das Gemeinschaft und Naturerfahrung verbindet.
Früh ansetzen: Kindern Selbstwirksamkeit vermitteln, Interesse wecken und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen – sie motivieren auch ihr Umfeld (Schmetterlingseffekt). - Handlungsfähigkeit stärken: Menschen sollen sich selbst als wertvollen Teil der Natur erleben und wahrnehmen.
Dialog fördern: Mit anderen Bevölkerungsgruppen vernetzen, Probleme und Chancen im Naturschutz thematisieren und unterschiedliche Sichtweisen verstehen. - Kreative Ansätze: Neue Methoden wie Kunst oder Film als Zugänge testen – noch experimentell, aber vielversprechend.
- Lebensrealität berücksichtigen: Angebote schaffen, die Menschen in ihrem Alltag abholen und motivieren.
- Hoffnung bewahren: „We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope“ (Martin Luther King).


Naturschutzjugend
im LBV
Eisvogelweg 1
91161 Hilpoltstein
09174/4775–7651
Die Naturschutzjugend im LBV (NAJU Bayern) ist die eigenständige Jugendorganisation des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V.