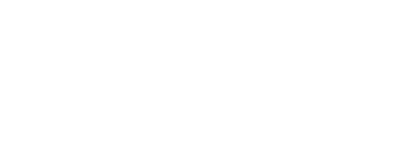Querverweise Deggendorf am 05.12.2024
Cities for Future: Naturräume neu gedacht
Mit Prof. Michael Laar, Dr. Norbert Schäffer, Agnes Becker, Dr. Peter Stimmler und Merle Raulfs
Moderation von Julia-Marie Hiller
Wie können Städte der Zukunft gestaltet werden, um nachhaltiger und lebenswerter auch für unsere heimische Tierwelt zu sein? Dieser Frage widmete sich die Podiumsdiskussion an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) am 5. Dezember. Gastgeber des Abends waren die THD, die LBV-Hochschulgruppe Deggendorf und die LBV-Kreisgruppe Deggendorf.
Nach der Begrüßung durch Julia Hiller, Koordinatorin der LBV-Hochschulgruppen, und Carmen Prinz von der LBV-Kreisgruppe Deggendorf eröffnete Prof. Michael Laar, Nachhaltigkeitsbeauftragter und Professor an der THD, die Diskussion mit einem Impulsvortrag.
Der Experte für nachhaltiges Bauen teilte Erfahrungen aus internationalen Projekten in Ländern wie Peru und Brasilien. Er betonte, dass in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte erzielt wurden, etwa bei der Luftqualität, Ozonbelastung und Energieeffizienz von Neubauten. Auch Konzepte für mehr Grün in Städten gibt es schon lange: Als Beispiel nannte er eine studentische Initiative zur Innenhofbegrünung in München, die bereits 1992 erfolgreich umgesetzt wurde. Zahlreiche weitere innovative Ansätze zur nachhaltigen Stadtgestaltung finden ebenfalls zunehmend Anwendung.
Prof. Laar erklärte, dass grüne und nachhaltige Städtentwicklung in der Regel in Ländern mit höherem Wohlstand umgesetzt werden, da Umweltprojekte meist erst nach der Deckung grundlegender gesellschaftlicher Bedürfnisse in Angriff genommen werden. Eine Umfrage in Deutschland verdeutlicht, dass Themen wie Krieg oder Arbeitsplatzsicherheit für viele Menschen derzeit Vorrang haben. Dennoch sieht Laar großes Potenzial, insbesondere durch lokale Initiativen wie das neue „Green Office“ der THD, das Nachhaltigkeitsprojekte direkt auf dem Campus vorantreiben soll.
Ziel der anschließenden Diskussion war es, interdisziplinäre Ansätze aufzuzeigen sowie die Herausforderungen und Chancen nachhaltiger Stadtgestaltung zu beleuchten. So können Naturräume in Städten, wie Grünflächen und unbewirtschaftete Ecken, durch gezielte Maßnahmen wieder zu Lebensräumen für Tiere werden. Norbert Schäffer (Vorsitzender des LBV) empfahl, Blühwiesen nach der Blüte stehen zu lassen und wilde Ecken in Stadtgärten zuzulassen. Diese naturnahen Gärten fördern die Artenvielfalt, sind weniger pflegeintensiv und kostengünstig. Merle Raulfs (Blühpakt-Beraterin der Regierung Niederbayern) ergänzte, dass Blühstreifen und Hecken zusätzlich einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität leisten. Zum Thema Vogelschlag erläuterten Michael Laar und Peter Stimmler (Projektleiter für Vogelschlagschutz an Glas), dass spezielle Folien mit kleinen silbrigen Punkten das Risiko von Kollisionen wirksam reduzieren können und so Vögel schützen.
Begrünte Dächer und Fassaden gewinnen ebenfalls an Bedeutung: Sie schaffen Lebensräume für Pflanzen und Tiere und verbessern das Stadtklima, so Laar. Stimmler mahnte jedoch, solche Flächen sorgfältig zu gestalten, da sie andernfalls Tiere anlocken, ohne ihnen geeigneten Lebensraum zu bieten („sink habitat“).
Auch Bürgerengagement spielt eine zentrale Rolle. Agnes Becker (Landesvorsitzende der ÖDP Bayern) betonte, dass vielen Menschen das Wissen um die frühere Vielfalt städtischer Natur fehlt. Aufklärung und Sensibilisierung seien daher essenziell.
Die Vision einer grünen, nachhaltigen Stadt erfordert also einen engen Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Bevölkerung. Konkrete politische Maßnahmen und gezielte Regelungen könnten helfen, urbane Räume lebenswerter für Mensch und Tier zu gestalten.
Handlungsempfehlungen
Probleme in Städten
Beispiele für fehlenden Lebensraum für Tiere: Mähroboter verletzen oder töten Igel, eingezäunte Gärten schränken ihre Bewegungsfreiheit ein. Mangel an Nistplätzen und Rückzugsorten sowie fehlendes Futterangebot erschweren das Überleben von Spatzen.
Vogelschlag: 5–10 % der Vögel sterben durch Vogelschlag, oft unbemerkt, da verletzte Tiere wegfliegen oder entfernt werden (Besonders kritisch in Zugzeiten).
Problematisch: Glasfassaden und hohe Gebäude fördern Vogelschlag, obwohl Glas für das menschliche Wohlbefinden vorteilhaft ist.
Lichtverschmutzung: Gartenbeleuchtung wird immer populärer, stellt jedoch eine tödliche Falle für Insekten dar.


Naturräume Schaffen
Mehr Unordnung zulassen: Grünflächen stehen lassen und erst nach der Blüte mähen. Infotafeln oder Plaketten wie „Vogelfreundlicher Garten“ fördern Akzeptanz bei Anwohnern.
Bedeutung von Parks und Gärten: Sie dienen als wichtige Rückzugsorte, müssen jedoch durchdacht gestaltet werden, um kein „sink habitat“ (ungeeigneter Lebensraum) zu schaffen.
Effektive Maßnahmen: Hecken pflanzen und Blühstreifen anlegen. Begrünte Dächer und Fassaden als nachhaltige Optionen.
Management: Richtiges und langfristiges Management ist entscheidend, um Naturräume effektiv zu schützen und zu fördern.
Bürgerengagement
Positive Verstärkung: Lob für Städte, die gute Ansätze umsetzen.
Bewusstsein schaffen: Artenkenntnis fördern, da viele nicht wissen, wie vielfältig die Natur früher war.
Menschen für die Natur begeistern und auf Missstände hinweisen.
Gemeinschaft mobilisieren: Bevölkerung aktiv einbinden, um Engagement zu fördern.

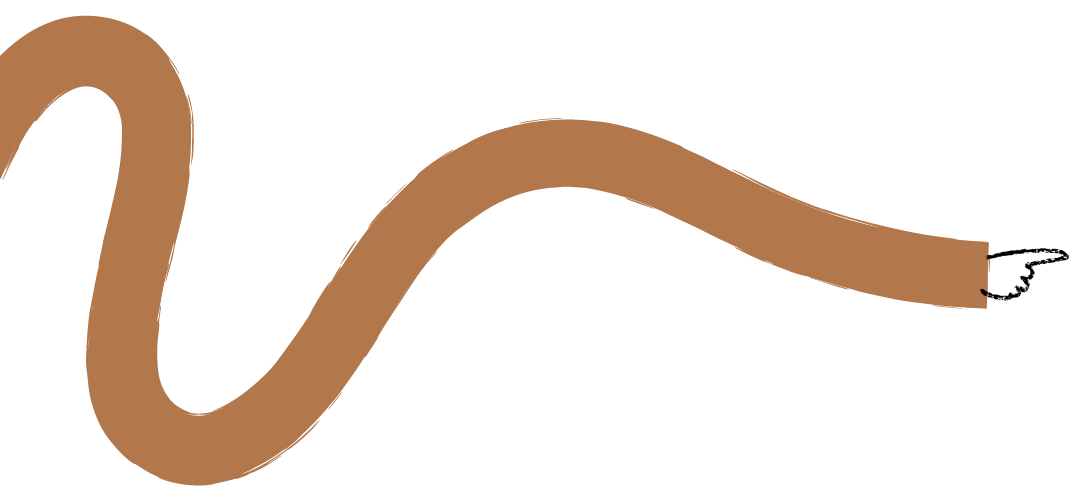
Kosten
Kosten und Pflege: Naturnahe Gärten sind pflegeleichter und kostengünstiger.
Investitionen in umweltschonendes Management können langfristig günstiger sein, auch wenn die Anschaffungskosten zunächst hoch sind.
Vision
Grünere Städte: Mehr Grünflächen und naturnahe Lebensräume im urbanen Raum
Bewusstsein für Tiere: Sensibilisierung der Bevölkerung für Tiere in der Stadt
Mensch und Natur: Die Verbindung zwischen Mensch und Natur stärken
Politische Maßnahmen: Verbindliche Regelungen und Verbote zum Schutz der Natur – analog zu anderen gesellschaftlich akzeptierten Verboten

Handlungs-
empfehlungen
Probleme in Städten
- Beispiele für fehlenden Lebensraum für Tiere: Mähroboter verletzen oder töten Igel, eingezäunte Gärten schränken ihre Bewegungsfreiheit ein. Mangel an Nistplätzen und Rückzugsorten sowie fehlendes Futterangebot erschweren das Überleben von Spatzen.
- Vogelschlag: 5–10 % der Vögel sterben durch Vogelschlag, oft unbemerkt, da verletzte Tiere wegfliegen oder entfernt werden (Besonders kritisch in Zugzeiten).
- Problematisch: Glasfassaden und hohe Gebäude fördern Vogelschlag, obwohl Glas für das menschliche Wohlbefinden vorteilhaft ist.
- Lichtverschmutzung: Gartenbeleuchtung wird immer populärer, stellt jedoch eine tödliche Falle für Insekten dar.
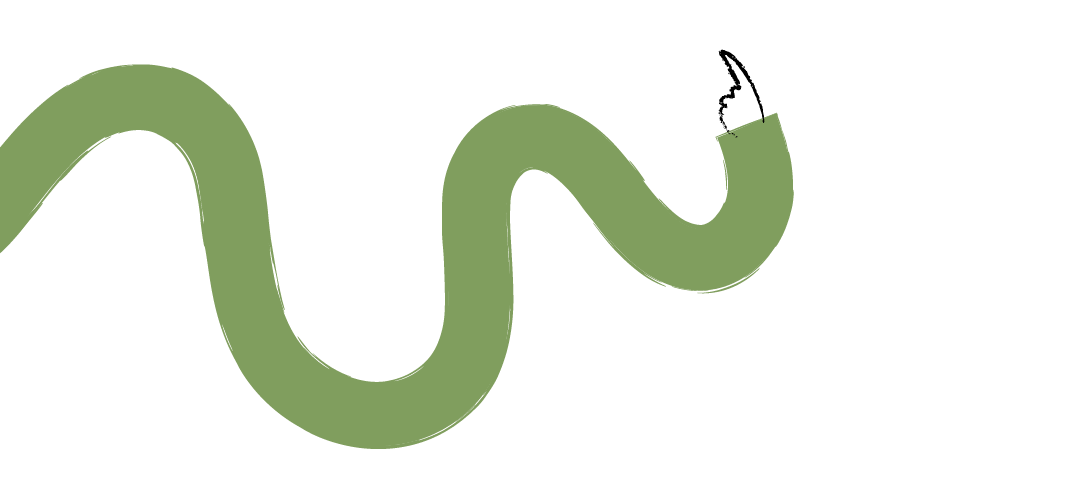
Naturräume Schaffen
- Mehr Unordnung zulassen: Grünflächen stehen lassen und erst nach der Blüte mähen. Infotafeln oder Plaketten wie „Vogelfreundlicher Garten“ fördern Akzeptanz bei Anwohnern.
- Bedeutung von Parks und Gärten: Sie dienen als wichtige Rückzugsorte, müssen jedoch durchdacht gestaltet werden, um kein „sink habitat“ (ungeeigneter Lebensraum) zu schaffen.
- Effektive Maßnahmen: Hecken pflanzen und Blühstreifen anlegen. Begrünte Dächer und Fassaden als nachhaltige Optionen.
- Management: Richtiges und langfristiges Management ist entscheidend, um Naturräume effektiv zu schützen und zu fördern.

Bürgerengagement
- Positive Verstärkung: Lob für Städte, die gute Ansätze umsetzen.
- Bewusstsein schaffen: Artenkenntnis fördern, da viele nicht wissen, wie vielfältig die Natur früher war.
- Menschen für die Natur begeistern und auf Missstände hinweisen.
- Gemeinschaft mobilisieren: Bevölkerung aktiv einbinden, um Engagement zu fördern.
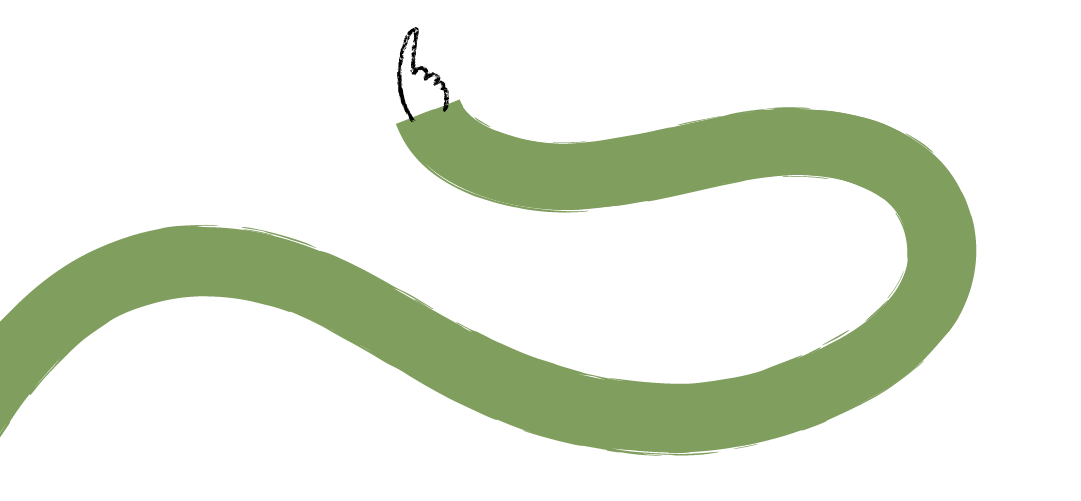
Kosten
- Kosten und Pflege: Naturnahe Gärten sind pflegeleichter und kostengünstiger.
- Investitionen in umweltschonendes Management können langfristig günstiger sein, auch wenn die Anschaffungskosten zunächst hoch sind.

Vision
- Grünere Städte: Mehr Grünflächen und naturnahe Lebensräume im urbanen Raum
- Bewusstsein für Tiere: Sensibilisierung der Bevölkerung für Tiere in der Stadt
- Mensch und Natur: Die Verbindung zwischen Mensch und Natur stärken
- Politische Maßnahmen: Verbindliche Regelungen und Verbote zum Schutz der Natur – analog zu anderen gesellschaftlich akzeptierten Verboten


Naturschutzjugend
im LBV
Eisvogelweg 1
91161 Hilpoltstein
09174/4775–7651
Die Naturschutzjugend im LBV (NAJU Bayern) ist die eigenständige Jugendorganisation des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V.